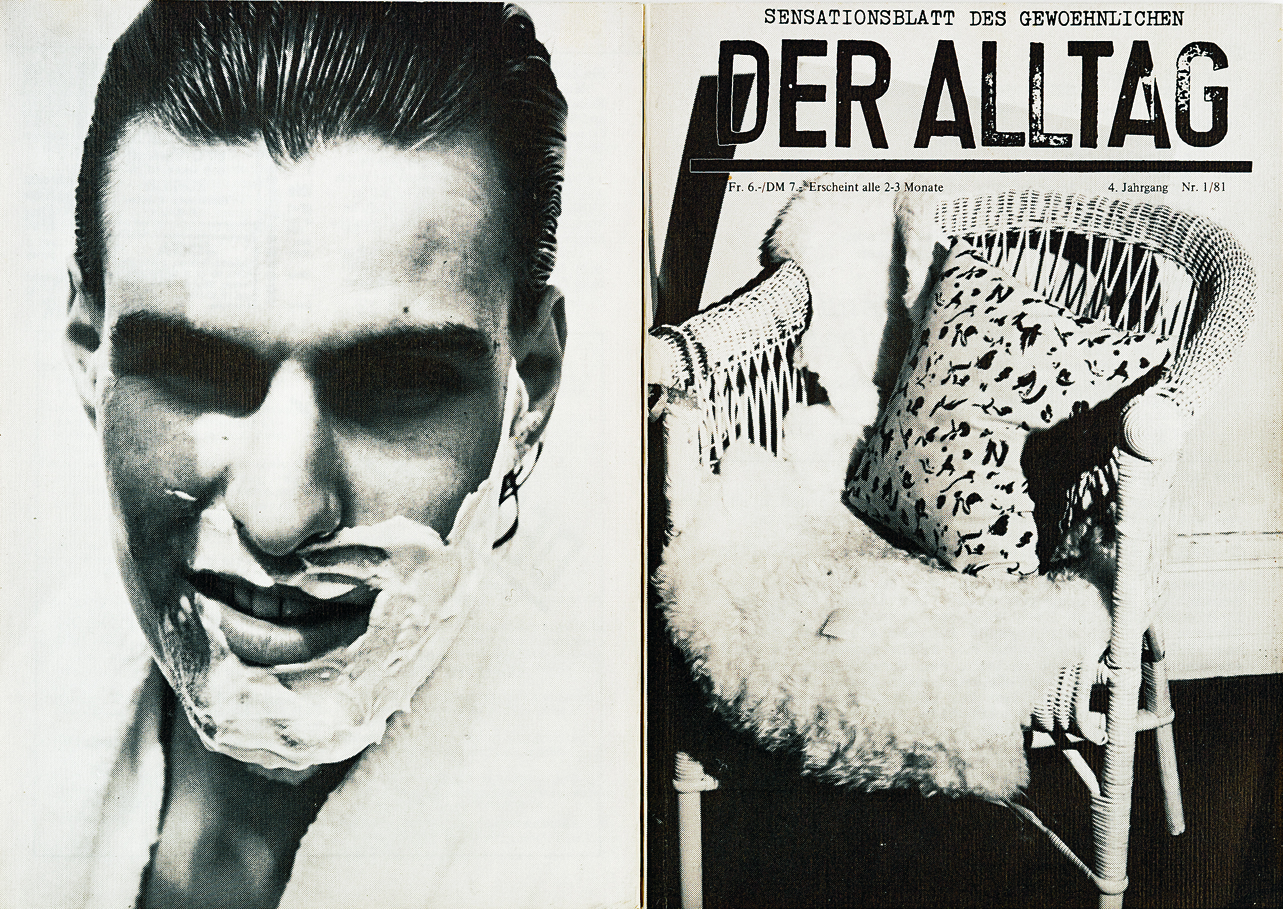BELIEVE IN YOURSELF. Sie trägt das Motto auf ihrem T-Shirt und ihre Pose ist Ausdruck natürlicher Selbstbestimmtheit. Die eine steht vor der Kamera, die andere dahinter. Beide kennen sich nicht, trotzdem scheint sich eine Vertrautheit beim Akt des Fotografierens einzustellen, die im Ergebnis erkennbar wird und ziemlich verblüfft.
Und noch mehr überrascht, wie sehr mich diese Porträts reinziehen in eine Lebenswelt, die mir eigentlich absolut nicht vertraut ist. Ich nehme es vorweg: Dies ist eine wunderbare Hymne auf das Jungsein, Freundschaft, Liebe, die Verheißungen des Lebens und es ist egal, ob man so jung wie die Jugendlichen, 30 oder gefühlte 100 Jahre alt ist, man findet sofort Zugang zu den Porträts. Selbstsicher posiert jene T-Shirt-Frau namens Jenny vor der Kamera von Christine Fenzl. Und so ist der Eindruck bei den Porträtierten fast ausnahmslos: Sehr selbstbewusst wirken die jungen Menschen. Euphorie über scheinbar unbegrenzte Möglichkeiten jugendlichen Daseins ist bei denen einen abzulesen, bei anderen schon die ersten Bürden, die ihnen als jungen Erwachsenen aufgeladen werden. Bunte Tattoos ranken sich über die Arme, die Haare sind gefärbt, Piercings komplettieren den Look und viele tragen T-Shirts und Caps mit Schriftzügen, die mir zwar nichts sagen, aber überaus stylish aussehen. So perfekt, so cool!

Man könnte auf den ersten, oberflächlichen Blick denken, hier sei eine Porträtserie über zugezogene Berlin-Mitte-Hipster entstanden. Dabei verhält es sich ganz anders in der bereits 2008 begonnenen Arbeit „Land in Sonne“, deren letztes Bild 2019 entstanden ist. Seit 1992 ist Fenzl in Berlin, sie erlebt mit, wie die Stadt sich verändert, wie exzessiv hier abgerissen und aufgebaut, renoviert und saniert wird, wie sämtliche Leerstellen gefüllt werden und wie der anfangs noch sichtbare Verlauf der ehemaligen Grenze rasend schnell verschwindet. Während Berlin städteplanerisch als Einheit betrachtet wird, fremdeln viele Bewohner in Ost und West lange mit den gesellschaftlichen Gegebenheiten oder wie es Nan Goldin, für die Fenzl in den frühen 90er assistiert, im Vorwort schreibt: Die Mauer als physische Abgrenzung ist zwar gefallen, aber es sind innere Grenzen geblieben. Christine Fenzl interessiert dieses Thema und sie wählt einen interessanten Ansatz: sie möchte jene jungen Menschen fotografieren, die während der Wende oder danach zur Welt gekommen sind, in deren Lebensbiographien ein gescheiterter Sozialismus genauso wie ein gesellschaftlicher Neubeginn eingeschrieben sind. Wo Eltern und Lehrer sich weiter unter dem Eindruck des Mauerfalls und Systemwechsels befinden, erhalten die Kinder eine Prägung von diesen, die ihre Lebenseinstellung determiniert? Nun, man kann nur vermuten, direkte Antworten kriegt man nicht.
mehr…